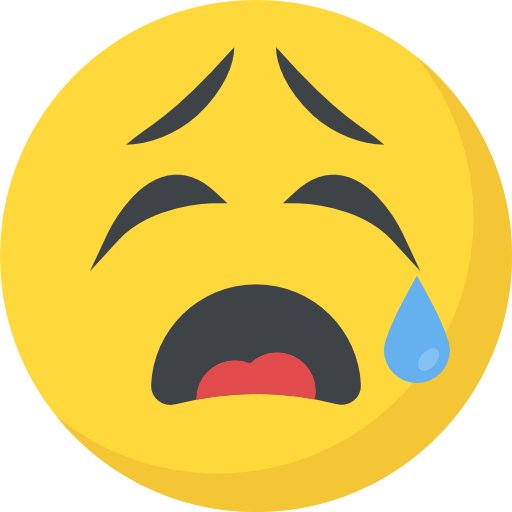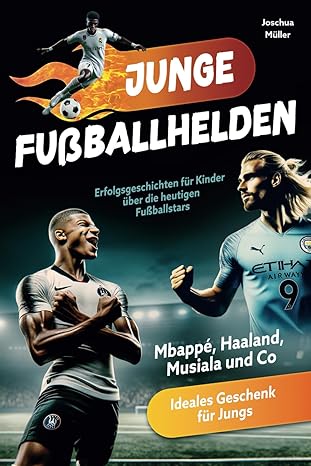Now Reading: Köbi Kuhn Fussballer Vermögen Skandale Familie
- 01
Köbi Kuhn Fussballer Vermögen Skandale Familie
Köbi Kuhn Fussballer Vermögen Skandale Familie

Er prägte die Schweizer Nationalmannschaft wie kaum ein anderer – doch hinter der Fassade des Volkshelden verbargen sich tiefe Brüche. Köbi Kuhn, der Mann mit der markanten Brille und herzlichen Art, wurde zum Symbol für Erfolg und Scheitern zugleich.
In über 40 Jahren als Spieler und Trainer sammelte er Titel, aber auch Schlagzeilen. Sein Leben war ein Wechselbad aus Meisterschaften mit dem FC Zürich und privaten Krisen, die ihn an den Rand der Pleite brachten.
Was trieb den Mann an, der Millionen begeisterte, aber selbst mit Millionenverlusten kämpfte? Dieser Artikel beleuchtet die Ambivalenz einer Ikone – jenseits der Stadionlichter.
Von Wiedikon zur Weltbühne: Kuhns legendäre Fussballkarriere
Mit 17 Jahren betrat er erstmals den Rasen als Profi – eine Legende war geboren. Der Fussballer durchlief alle Jugendmannschaften des FC Zürich, ehe er 1961 sein Debüt feierte. Sein Markenzeichen: Präzise Pässe und eine unermüdliche Arbeitsmoral.
Jugend und Durchbruch beim FC Zürich
Seine frühen Jahre beim FC Wiedikon waren geprägt von Talent und Kontroversen. 2016 wies er Vorwürfe sexuellen Missbrauchs während seiner Jugendzeit zurück. Sportlich überzeugte er früh: Beim 11:0 gegen Lugano schoss er vier Tore – ein Rekord, der bis heute fasziniert.
Loyalität bestimmte seine Laufbahn. Trotz Angeboten von AC Mailand und Olympique Marseille blieb er dem FCZ treu. In 554 Spielen traf er 103 Mal – eine Bilanz, die ihn zum Vereinssymbol machte.
Erfolge mit der Schweizer Nationalmannschaft
Als Spieler stand er zweimal bei Weltmeisterschaften (1962, 1966) auf dem Platz. Das 0:5 gegen Deutschland 1966 wurde zum Lehrstück – Kuhn verletzte den Zapfenstreich und provozierte so eine historische Niederlage.
| Station | Spiele | Tore | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| FC Zürich (1960-1977) | 554 | 103 | Rekordspieler |
| Schweizer Nati (WM 1966) | 3 | 0 | Kapitän |
Die prägenden Jahre als Nationaltrainer
Von 2001 bis 2008 formte er als Trainer eine neue Generation. Sein Vertrauen in junge Talente wie Tranquillo Barnetta zahlte sich aus: Die Mannschaft qualifizierte sich für EM 2004 und WM 2006.
Sein Abschied 2008 wurde mit einer “Merci Köbi”-Choreo gefeiert. 76% der Fans sprachen sich in Umfragen für seinen Verbleib aus – ein Beleg für seine emotionale Verbindung zum Publikum.
Köbi Kuhn Pleite: Der finanzielle Absturz eines Volkshelden
![]()
Nicht nur auf dem Platz, auch im Geschäftsleben erlebte er Höhen und Tiefen. Während er als Trainer den FC Zürich betreute, stürzte er privat in eine tiefe Krise. Die Jahre 1983 bis 1987 markierten das Ende seiner finanziellen Stabilität.
Das gescheiterte Versicherungsgeschäft
Ohne kaufmännische Erfahrung wagte er den Sprung in die Selbstständigkeit. Seine “Köbi Kuhn Versicherungen” scheiterten kläglich.
“Ich war naiv und vertraute den falschen Leuten”,
gestand er später.
Konkurseröffnung in den 1980er Jahren
1987 war die Zeit der Schulden nicht mehr zu stoppen. Das Gericht eröffnete das Konkursverfahren. Über eine Million Franken Verlust lasteten auf ihm – ein Schock für den bescheiden lebenden Familienvater.
Verluste von über einer Million Franken
Im Alter von 45 Jahren stand er vor dem Nichts. Trotz seines Ruhms half ihm niemand aus der Misere. Erst die Anstellung beim Schweizerischen Fussballverband ab 1995 sicherte sein Auskommen.
Sein Fall zeigt: Auch Idole sind nicht vor Fehlentscheidungen gefeit. Doch er kämpfte sich zurück – ohne je die Hoffnung zu verlieren.
Skandale und Kontroversen im Leben des Fussballidols
Die Medien feierten ihn – doch sie rissen auch Wunden auf. Hinter der Legende verbargen sich unschöne Wahrheiten, die sein Image als volksnaher Sportler zeitweise überschatteten.
Missbrauchsvorwürfe aus Kindheitstagen
2019 brach ein Tabu: Vorwürfe sexuellen Missbrauchs in seiner Jugend beim FC Wiedikon wurden publik. Köbi Kuhn stritt eine Täterschaft ab, gestand aber „traumatische Erlebnisse“ ein. Seine Familie stand während der Debatte hinter ihm.
Erst in seiner Autobiografie 2019 thematisierte er die Vorwürfe offen – ein spätes Bekenntnis zu inneren Kämpfen.
Gescheiterte politische Ambitionen für die SVP
2008 kandidierte er überraschend für die SVP im Zürcher Kantonsrat. Seine Rolle als unpolitische Ikone geriet ins Wanken:
„Ich wollte etwas bewegen – doch Politik ist kein Spiel mit klaren Regeln.“
Die Niederlage markierte das Ende seiner kurzen politischen Karriere.
Kritik an seiner Trainermethodik
Als Nationaltrainer polarisierte er:
- 4-4-2-Taktik: Als „veraltet“ von Experten geschmäht
- Selektion: Vorwurf der Bevorzugung Deutschschweizer
- Führungsstil: Zu nah an Spielern, zu wenig professionell
Die Entlassung von Ciriaco Sforza 2004 löste eine Medien-Debatte über seine Entscheidungen aus.
| Kontroverse | Jahr | Folgen |
|---|---|---|
| Missbrauchsvorwürfe | 2019 | Image-Schaden |
| SVP-Kandidatur | 2008 | Politische Isolation |
| Sforza-Entlassung | 2004 | Fachliche Kritik |
Familientragödien: Schicksalsschläge hinter den Kulissen

Hinter den Erfolgen verbarg sich ein Leben voller Schicksalsschläge. Während die Schweiz ihren Volkshelden feierte, kämpfte er privat mit Verlusten, die ihn bis ins Mark trafen.
Der Tod seiner Ehefrau Alice 2014
Nach 49 gemeinsamen Jahren traf ihn der Schicksalsschlag unerwartet. Seine Frau Alice erlag 2014 einem Hirnschlag – sie war nicht nur seine Lebenspartnerin, sondern auch Managerin seiner Karriere.
Ihr Tod hinterließ eine Lücke, die er öffentlich kaum thematisierte. Hinter verschlossenen Türen verarbeitete er den Verlust jedoch schwer.
Das verstörende Schicksal der Tochter Viviane
Noch härter traf ihn der Verlust seiner Tochter. Viviane kämpfte jahrelang mit psychischen Erkrankungen und Drogenproblemen. 2018 starb sie mit nur 46 Jahren.
Dieser Schlag traf ihn tiefer als jede Niederlage auf dem Platz. „Ein Vater sollte sein Kind nicht begraben müssen“, vertraute er Freunden an.
Kuhns eigener Kampf gegen Leukämie
Bereits 2013 diagnostizierten Ärzte bei ihm Leukämie. Trotz Chemotherapien und Klinikaufenthalten blieb er öffentlich stark. Jahre später, im November 2019, verschlechterte sich sein Zustand jedoch dramatisch.
Sein Lebensmut beeindruckte selbst Mediziner. Bis zuletzt kämpfte er – wie einst auf dem Fußballplatz.
Volksheld trotz allem: Warum die Schweiz Köbi liebte
Die Schweiz liebte ihn nicht trotz, sondern wegen seiner Authentizität. Während andere Stars der schweizer nationalmannschaft sich abhoben, blieb er stets er selbst. Diese Einzigartigkeit machte ihn zum köbi national-Phänomen.
Authentizität in der Welt des Profifussballs
Als trainer verzichtete er auf Starallüren. Sein Telefonbuch-Eintrag während der WM-2006-Zeit wurde zum Symbol. “Ein echter Star braucht kein Geheimnis um seine Nummer”, kommentierte er trocken.
Seine Wohnung in Zollikerberg – keine Villa, sondern ein bescheidenes Domizil. Einkäufe in der Migros machten ihn für menschen greifbar. Diese Bodenständigkeit schuf Vertrauen.
Sein bescheidener Lebensstil trotz Ruhms
Der Kontrast zu heutigen Social-Media-Stars könnte größer nicht sein. Während andere Luxus zur Schau stellten, lebte er seinen Alltag:
- Keine teuren Autos – stattdessen öffentliche Verkehrsmittel
- Kein Promi-Gehabe – stattdessen Gespräche mit Fans
- Kein abgehobenes Image – stattdessen volksnaher Charme
Die emotionale Verbindung zu den Fans
Sein Tränenmoment bei der WM 2006 ging ins Nationalgedächtnis ein. Als trainer verstand er es, menschen zu berühren. Der “Köbi-Kuhn-Platz” in Wiedikon zeigt bis heute diese Verbindung.
Generationen fanden durch ihn zusammen – von den 1960ern bis 2000ern. Seine zeitlose Art machte ihn zum Sprachrohr der “einfachen Schweiz”. Ein köbi national-Phänomen, das seinesgleichen sucht.
Fazit: Das bittersüße Vermächtnis eines Schweizer Originals
Als letzter Vertreter einer vergangenen Ära prägte er den Fussball jenseits des Kommerzes. Sein Leben war geprägt von Titelgewinnen, finanziellen Abstürzen und privaten Tragödien – eine Bilanz, die ihn zum „gebrochenen Helden“ machte.
Als Trainer setzte er auf Menschlichkeit statt Marketing. Sein Credo: „Ich war für Spieler kein Einfacher, aber ein Ehrlicher.“ Diese Haltung wirkt jahre später nach – als Gegenentwurf zur heutigen Sportindustrie.
Sein Tod 2019 markierte das Ende einer Ära. Doch sein Erbe lebt fort: als Mahnmal für Fehlbarkeit und Vorbild für Bodenständigkeit. In einer Zeit der Inszenierung bleibt er unerreicht – ein echtes Schweizer Original.