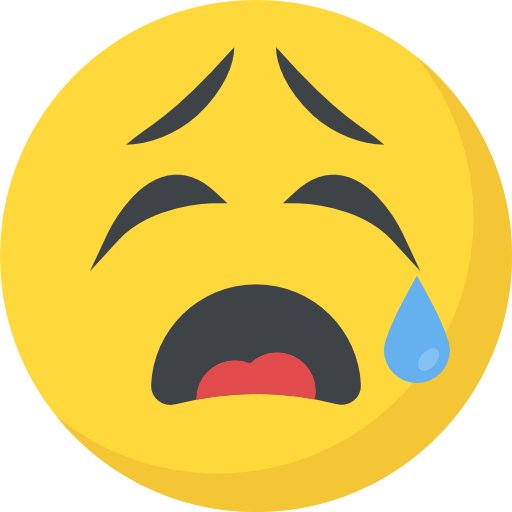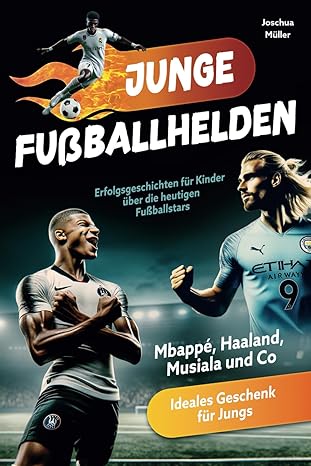Now Reading: Frauenfußball im Wandel – Von Verboten zu Weltmeisterinnen
-
01
Frauenfußball im Wandel – Von Verboten zu Weltmeisterinnen
Frauenfußball im Wandel – Von Verboten zu Weltmeisterinnen

Der Frauenfußball erlebt heute einen nie dagewesenen Boom. Beim WM-Spiel 2023 verfolgten 5,61 Millionen Zuschauer*innen das Spiel – ein Marktanteil von 60%. Diese Rekordzahlen zeigen: Der Sport hat sich von einem Nischenphänomen zur gesellschaftlichen Bewegung entwickelt.
Doch der Weg war steinig. Noch 1955 verbot der DFB offiziell den Frauenfußball. Trotzdem kickten in den 1960ern rund 60.000 Frauen heimlich. Erst 1970 wurde das Verbot aufgehoben. Heute sind über eine Million Mädchen und Frauen aktiv im Vereinssport.
Die Geschichte des Frauenfußballs spiegelt gesellschaftliche Konflikte wider. Während 1920 schon 53.000 Fans ein Spiel verfolgten, erhielten Männer 1989 64.000 Euro Bonus – Frauen nur ein Kaffeeservice. Doch die WM-Erfolge und Rekordzuschauerzahlen beweisen: Der Wandel ist unaufhaltsam.
Die Anfänge: Ein Sport im Schatten der Männer
In den 1920er und 1930er Jahren kämpften Pionierinnen für ihren Platz auf dem Fußballplatz. Während Männer bereits große Stadien füllten, wurden Spielerinnen belächelt oder sogar angefeindet. Doch einige Frauen ließen sich nicht beirren.
Lotte Specht und der erste deutsche Damen-Fußballklub
1930 gründete Lotte Specht den 1. DDFC Frankfurt – den ersten Frauenfußballverein Deutschlands. “Wir wollten zeigen, dass Mädchen genauso gut kicken können”, erklärte sie damals. Der Verein entstand durch eine Zeitungsannonce und zog schnell Interessentinnen an.
Doch die Hürden waren enorm:
- Der DFB verweigerte jede Unterstützung
- Es gab keine offiziellen Spielstätten
- Nach einem Jahr musste der Verein aufgelöst werden
Interessanterweise gab es ähnliche Entwicklungen in England. Dort wurde der Frauenfußball 1921 sogar komplett verboten – ein Verbot, das bis 1970 bestehen blieb. Mehr zur internationalen Geschichte des Frauenfußballs zeigt diese Parallelen deutlich.
Presse und Gesellschaft: Hohn statt Anerkennung
Die Reaktionen der Öffentlichkeit waren erschreckend. Zeitungen bezeichneten die Spielerinnen als “Mannweiber”. Bei Spielen flogen sogar Steine auf den Platz. Viele sahen den Sport als Bedrohung für die traditionelle Rollenverteilung.
Dabei hatten die Frauen klare Ziele:
- Sportliche Betätigung für Mädchen ermöglichen
- Gleichberechtigung im Sport vorantreiben
- Vorurteile durch Leistung widerlegen
Die Debatten dieser Zeit erinnern auffällig an heutige Diskussionen um Gleichstellung. Der Kampf der ersten Generationen zeigt: Veränderung braucht Mut und Ausdauer.
Das Verbot von 1955: Fußball als “unweiblich”
Das Jahr 1955 brachte einen Rückschlag – der DFB erklärte Fußball für “unweiblich”. Offiziell durften Frauen nun nicht mehr kicken. Die Begründungen wirken heute absurd: Der Sport schade der “weiblichen Schicklichkeit”.
Die fragwürdige Begründung des DFB
Der DFB stützte sich auf pseudo-wissenschaftliche Thesen. Mediziner wie Frederik J. J. Buytendijk behaupteten:
“Fußball gefährde die weibliche Seele.”
Dabei ging es weniger um Fakten – eher um Rollenbilder. Frauen sollten sich auf “schickliche” Sportarten beschränken.
Juristisch war das Verbot angreifbar. Es widersprach dem Grundgesetz (Artikel 3: Gleichberechtigung). Doch in der Nachkriegszeit setzte sich der DFB durch.
Inoffizielle Länderspiele und wachsender Widerstand
Vereine wie Grün-Weiß Dortmund ignorierten das Verbot. Heimlich organisierten sie Spiele – 1956 kamen 18.000 Fans! Die Neue Ruhr Zeitung berichtete positiv über die Spiele.
Der Widerstand formierte sich:
- Alternative Verbände entstanden (z. B. Westdeutsche Damen-Fußball-Verband)
- Fans unterstützten die Spielerinnen trotz Steinen und Beschimpfungen
- Internationale Spiele zeigten: Frauen konnten genauso begeistern wie Männer
Die Zuschauerzahlen bewiesen: Das Verbot war realitätsfremd. 1957 sahen 14.000 Menschen ein Spiel in Essen. Der DFB hatte die Stimmung falsch eingeschätzt.
1970: Der Wendepunkt für den Frauenfußball
1970 markierte einen historischen Meilenstein für den Sport. Am 31. Oktober hob der DFB das 15 Jahre alte Verbot endgültig auf. Dieser Entscheid veränderte alles – doch die neuen Regeln zeigten widersprüchliche Signale.
Aufhebung des Verbots und erste Auflagen
Die Freude über die Legalisierung wurde durch bizarre Einschränkungen getrübt. Der DFB führte spezielle Regeln ein:
- Jugendbälle statt normale Fußbälle
- Spielzeit auf 2×30 Minuten begrenzt
- Gymnastikschläppchen im Training vorgeschrieben
Hannelore Ratzeburg, spätere DFB-Vizepräsidentin, erinnert sich:
“Diese Regeln sollten uns vermeintlich schützen. In Wahrheit waren sie diskriminierend.”
| Einschränkung | Begründung | Wirkung |
|---|---|---|
| Jugendbälle | Schonung der “weiblichen Anatomie” | Technische Spielweise erschwert |
| Kürzere Spielzeit | Verminderte Belastung | Konditionelles Training vernachlässigt |
| Schläppchen-Pflicht | Verletzungsprävention | Eingeschränkte Bewegungsfreiheit |
Die Rolle der 68er-Bewegung
Gesellschaftliche Veränderungen beschleunigten den Wandel. Die Studentenproteste forderten auch im Sport Gleichberechtigung. Zwischen 1968 und 1970 verdoppelte sich die Zahl der Spielerinnen auf 60.000.
Medienstrategien des DFB zielten auf Imagekorrektur. Doch die 68er-Bewegung setzte echte Reformen durch. Ihr Erfolg zeigte: Frauenfußball war kein Nischenthema mehr, sondern Teil des gesellschaftlichen Umbruchs.
Frankreich erkannte den Sport im selben Jahr offiziell an. 1971 folgte das erste Länderspiel – ein 4:0 gegen die Niederlande. Europaweit begann eine neue Zeit.
Die Entwicklung des Frauenfußballs in der DDR

Während der Westen Frauenfußball lange verbot, etablierte sich der Sport in der DDR durch einzigartige Strukturen. Der Betriebssport wurde zum Rückgrat – finanziert von staatlichen Kombinaten wie dem Energiekombinat Potsdam.
Betriebssport und regionale Förderung
Spielerinnen erhielten Trainingsfreistellungen und Material. Teams wie Turbine Potsdam rekrutierten Talente aus ganzen Bezirken. Ein Zeitzeuge berichtet:
“Unsere Ausrüstung kam vom Betrieb – sogar die Trikots wurden dort genäht.”
Die erste Meisterschaft 1979 war ein Meilenstein. Bis 1990 dominierten Vereine aus Potsdam, Jena und Chemnitz.
Turbine Potsdam: Ein Leuchtturm des Ostens
Bernd Schröder trainierte das Team von 1971 bis 2016. Unter ihm gewann Potsdam sechs DDR-Titel und später zwei Champions-League-Trophäen. Die Förderung durch das Energiekombinat ermöglichte:
- Professionelle Trainingsbedingungen
- Reisen zu internationalen Turnieren
- Langfristige Karriereplanung
| Jahr | Meister | Besonderheit |
|---|---|---|
| 1979 | BSG Wismut Chemnitz | Erste offizielle Meisterschaft |
| 1990 | BSG Post Rostock | Letzter Titel vor der Wiedervereinigung |
Nach 1990 kämpften viele Vereine ums Überleben. Doch Potsdam blieb – dank Schröders Netzwerk – eine Macht im deutschen Fußball.
Europameister 1989: Der erste große Triumph
Ein Kaffeeservice als Siegprämie: Die EM 1989 offenbarte die Diskrepanz zwischen sportlichem Erfolg und Wertschätzung. 22.000 Zuschauer im Osnabrücker Stadion erlebten historische Momente – doch die materielle Anerkennung blieb weit hinter den Leistungen zurück.
Das Finale gegen Norwegen und die Blümchen-Prämie
Silvia Neids Siegtor in der 63. Minute bescherte Deutschland den Titel. Doch statt üppiger Prämien erhielten die Spielerinnen ein Villeroy & Boch-Kaffeeservice. Zeitungen titelten spöttisch: “Blümchen statt Blankoschecks”.
Die Unterschiede waren eklatant:
- Männer: 64.000 Euro pro Spieler (EM 1988)
- Frauen: Porzellan im Wert von 150 D-Mark
- TSV Siegen: Jahresbudget von 200.000 D-Mark
“Wir haben Europameisterinnen gefeiert – und am nächsten Tag wieder im Krankenhaus gearbeitet”, erinnert sich Andrea Haderlass, die mit 26 Jahren aus finanziellen Gründen aufhörte.
Medieninteresse vs. finanzielle Gleichstellung
Obwohl SPIEGEL und Talkshows die Spielerinnen porträtierten, fehlte nachhaltiges Sponsoring. Marion Isbert wurde zur Galionsfigur, doch die Medien inszenierten oft Klischees statt sportlicher Leistung.
| Aspekt | Männerfußball | Frauenfußball 1989 |
|---|---|---|
| Prämien | 5-stellige Beträge | Materielle Geschenke |
| Karriereoptionen | Vollprofis | Berufstätigkeit parallel |
Silvia Neid – später Nationaltrainerin – symbolisiert den Wandel. Ihr Werdegang zeigt: Der Titel war ein Meilenstein, doch der Kampf um Gleichstellung hatte gerade erst begonnen.
Weltmeisterinnen und globale Anerkennung

Mit zwei WM-Titeln schrieb die deutsche Nationalmannschaft Geschichte. 2003 und 2007 triumphierte das Team – und setzte neue Maßstäbe. Diese Erfolge veränderten die Wahrnehmung des Sports nachhaltig.
Die Titelgewinne 2003 und 2007
2003 besiegte Deutschland Schweden im Finale mit 2:1. Vier Jahre später folgte der nächste Titel gegen Brasilien. Prämien stiegen von 65.000€ (2019) auf 270.000€ pro Spielerin 2023.
Sponsoren wie VW und Commerzbank erkannten das Potenzial. Sie investierten in:
- Professionelle Trainingszentren
- Nachwuchsförderprogramme
- Medienkampagnen
“Diese Titel bewiesen: Frauenfußball kann Stadien füllen und Emotionen wecken”, sagt eine ehemalige Spielerin.
Die USA als Vorreiterinnen
Die USA setzten 2019 mit einer Sammelklage neue Standards. Spielerinnen wie Alex Morgan kämpften erfolgreich für gleiche Bezahlung. Ihr Argument: Die Nationalmannschaft erzielte höhere Umsätze als die Männer.
| Land | WM-Prämie 2023 | Vereinsgehälter |
|---|---|---|
| Deutschland | 270.000€ | 39.000€ (Durchschnitt) |
| USA | 400.000$ | 72.000$ (NWSL) |
Die FIFA reagierte mit höheren Preisgeldern. 2023 gab es 570 Millionen Dollar Umsatz – ein Rekord. Doch die Gleichberechtigung bleibt ein zentrales Thema.
Deutsche Spielerinnen profitieren von dieser Entwicklung. Die Weltmeisterinnen von einst sind heute Vorbilder – auf und neben dem Platz.
Frauenfußball heute: Zwischen Boom und Barrieren
Die aktuelle Situation im Frauenfußball zeigt ein paradoxes Bild: Nie zuvor war das Interesse größer, doch strukturelle Hürden bleiben bestehen. Während die Zuschauerzahlen explodieren, kämpfen viele Vereine noch immer mit grundlegenden Finanzfragen.
Rekordzuschauer und ungelöste Finanzfragen
Die Saison 2023/24 verzeichnete 380.000 Besucher in der Frauen-Bundesliga – ein Plus von 6%. Spiele wie Köln gegen Frankfurt lockten 38.365 Fans ins Stadion. Diese Zahlen belegen den Boom.
Doch hinter den Kulissen zeigt sich ein anderes Bild:
- Durchschnittsgehälter liegen bei 39.000€ (USA: 72.000$)
- Hospitality-Pakete bis 200€, normale Tickets ab 7€
- DFB plant Verdopplung der Zuschauer bis 2028
“Wir spielen vor vollen Rängen, aber die Infrastruktur hinkt hinterher”, so eine Bundesliga-Spielerin.
Die FIFA-WM 2023 und die Prämien-Debatte
Die FIFA-WM 2023 brachte neue Maßstäbe. Spielerinnen erhielten 30.000 USD Basisprämie – ausbezahlt über Verbände. Zum Vergleich: 1989 gab es ein Kaffeeservice.
| Jahr | Prämie | Medienwert |
|---|---|---|
| 1989 | 150 DM (Material) | Lokalberichterstattung |
| 2023 | 270.000€ | Globales Sponsoring |
England zeigt, wie es besser geht. Die WSL führt mit 6.000 Zuschauern pro Spiel. Sponsoring-Deals wie bei Barclays setzen neue Standards. In Deutschland fehlt oft dieser Mut zu Investitionen.
Junge Fans entdecken den Sport neu. 60% der Zuschauer sind unter 35. Dieser Generationenwechsel gibt Hoffnung – wenn die Finanzen mitspielen.
Gesellschaftlicher Impact: Mehr als nur ein Spiel
Die Strahlkraft des Sports reicht weit über den Rasen hinaus. Heute nutzen 1 Million aktive Spielerinnen im DFB den Fußball als Plattform für Empowerment. Was als Freizeitbeschäftigung begann, entwickelt sich zur sozialen Bewegung.
Fußball als Katalysator für Gleichberechtigung
Soziologische Studien zeigen: Teamsport bricht Geschlechterstereotypen. Mädchen, die Fußball spielen:
- Entwickeln stärkeres Selbstbewusstsein
- Lernen Führungskompetenzen
- Brechen mit traditionellen Rollenbildern
Der DFB fördert diese Entwicklung durch Programme wie “FF27”. Seit 2021 wurden 90 Frauen in Führungspositionen gebracht. Kooperationen mit BMZ und GIZ zeigen: Fußball wird zum Werkzeug für globale Gleichberechtigung.
| Bereich | 1990 | 2024 |
|---|---|---|
| Vereinsmitglieder | 250.000 | 1.000.000+ |
| Trainerinnen | 12% | 34% |
| Schul-AGs | 150 | 2.800 |
Vorbilder für die nächste Generation
Spielerinnen wie Alexandra Popp oder Lena Oberdorf werden zu Identifikationsfiguren. Ihre Karrieren zeigen:
- Profisport ist für Frauen möglich
- Duale Karrieren (Sport/Beruf) funktionieren
- Intersektionale Vielfalt (LGBTQ+, Migration) gehört dazu
“Wir kämpften für Normalität – heute kickt meine Tochter selbstverständlich in der Schulmannschaft”, sagt Nationalspielerin Jasmine.
Bildungspolitische Initiativen verstärken diesen Effekt. Bundesweit entstehen Mädchen-AGs. Die FIFA-GIZ-Projekte nutzen den Sport gezielt gegen Diskriminierung. So wird der Platz zum Klassenzimmer für Gesellschaftswandel.
Fazit: Der lange Weg zur Normalität
Was einst als ‘unweiblich’ galt, ist heute ein Symbol für Gleichberechtigung und sportliche Exzellenz. Die historischen Erfolge – von heimlichen Spielen bis zu WM-Titeln – zeigen einen kulturellen Wandel. Doch die zyklischen Muster von Diskriminierung und Akzeptanz mahnen zur Wachsamkeit.
Verbände müssen jetzt handeln: Professionelle Strukturen bringen wirtschaftliches Potenzial. Die EM 2025 könnte 400 Millionen Zuschauer erreichen. Wie Expertinnen betonen, ist Investition in Infrastruktur kein Kostenpunkt, sondern eine Chance.
Die Gesellschaft hat erkannt: Fußball ist kein Männersport. Junge Spielerinnen sehen in Stars wie Popp Vorbilder. Diese Strahlkraft nutzen Projekte wie “FF27” für sozialen Wandel.
Die Zukunft gehört einem Sport, der Barrieren bricht. Oder wie eine Pionierin sagt: “Wir spielen nicht gegen Vorurteile – wir spielen für die nächste Generation.”